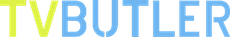Punkt eins Wie wir Kinder optimal fördern
Mo, 24.06. | 13:00-13:55 | Ö1
Sie sind schon lange keine „Tanten“ mehr, aber auch keine Betreuerinnen. Aus Sicht der Neurowissenschaft ist klar: Elementarpädagoginnen sind die Schlüsselkräfte, wenn es um die kognitive Entwicklung von Kleinkindern geht. Das soziale Umfeld spielt für eine gesunde Gehirnentwicklung eine prägende Rolle. Wie können wir als Gesellschaft junge Menschen in ihrer Entwicklung optimal fördern? Welche Bedingungen braucht es, wie muss Elementarbildung gestaltet sein, damit sich Kinder kognitiv, sozial und emotional optimal entwickeln können? In den letzten Jahren ist das Verständnis der Gehirnentwicklung stetig gewachsen. Heute weiß man, dass Erfahrungen und vor allem soziale Interaktionen der Motor der Entwicklung sind und die ersten fünf Lebensjahre für eine gesunde Gehirnentwicklung entscheidend, auch wenn es über 20 Jahre dauert, bis alle Regionen des Gehirns ausgereift und voll entwickelt sind. Neuroplastizität ist das Schlagwort, mit dem Forscherinnen und Forscher die erstaunliche Anpassungsfähigkeit des Gehirns beschreiben, die während der gesamten Lebensspanne eine Art Selbst-Restrukturierung des Gehirns ermöglicht. Eine Formbarkeit, die dafür sorgt, dass wir uns flexibel an wechselnde Umweltbedingungen anpassen können. Die Neuroplastizität, die Grundlage für vielfältigste Lernprozesse, ist in den ersten Lebensjahren besonders hoch. Doch sie macht das sich entwickelnde Gehirn anfällig für negative Einflüsse aus der Umgebung. Die Neurowissenschaftlerin Isabella Sarto-Jackson erforscht die konstruktiven und die destruktiven Wirkkräfte und Mechanismen, die neuroplastische Prozesse vorantreiben. Werden Kinder vernachlässigt, erleben sie Missbrauch oder Kinderarmut, verändert das ihr Gehirn und damit ihre Kompetenzen und ihre Weltsicht dauerhaft. Gezielte Frühförderung ermöglicht Kleinkindern mit Entwicklungsrisiko (Frühgeburt), Entwicklungsverzögerung oder Behinderung noch viel „aufzuholen“. Und viele Eltern wollen ihre Kinder möglichst optimal fördern – braucht es dafür einen Sprachkurs oder Vorschulübungen? Empirische Studien belegen eindrucksvoll, dass eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung, Betreuung und Förderung eine Reihe positiver Effekte haben: ökonomisch, sozial und pädagogisch, für das Individuum wie für die Gesellschaft und die Volkswirtschaft. Vorschulische Bildungsarbeit und Förderung ist für den Staat auch deutlich kostengünstiger als entsprechende Versäumnisse (beispielsweise beim Spracherwerb) später zu kompensieren und mit den Herausforderungen einer chancen- und bildungsungleichen Gesellschaft zurecht zu kommen. Wie die praktische Umsetzung einer entwicklungsfördernden Elementarpädagogik gelingt, zeigt zum Beispiel der Alltag im Bildungsgarten in Graz. 1992 als erster interkultureller Kindergarten mit muttersprachlicher Begleitung in der Steiermark gegründet, werden dort etwa 50 Kinder aus 15 bis 25 Nationen begleitet. Auf die Mehrsprachigkeit der Kinder reagiert man beispielsweise mit einem mehrsprachigen Team und einer Quotenlösung bei der Aufnahme der Kinder. Die Leiterin des Bildungsgartens Graz, Sandra Meiser-Lang, und die Neurowissenschaftlerin Isabella Sarto-Jackson sind aus Anlass einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Frühkindliche Förderung aus wissenschaftlicher Sicht“ auf Einladung des Bildungsministeriums am Montag in Wien und davor Gäste in Punkt eins bei Barbara Zeithammer. Was bedeutet Frühförderung, wie sehen optimale Bildungsangebote im Kindergarten aus und womit müssen Elementarbildungseinrichtungen ausgestattet sein, um ihre Aufgaben erfüllen zu können? Besteht die Gefahr, Kindern zu überfordern und welche Fähigkeiten stellen wir als Gesellschaft in den Mittelpunkt, welche vernachlässigen wir in der Debatte? Diskutieren Sie mit, erzählen und berichten Sie von Ihren Erfahrungen und stellen Sie Ihre Fragen per E-Mail an punkteins(at)orf.at oder unter 0800 22 69 79 telefonisch während der Sendung.
in Outlook/iCal importieren