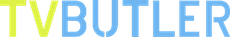Ein Tag in Dresden 1946
So, 09.02. | 1:30-2:15 | Phoenix
Es ist der 16. September 1946 mehr als ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die vier Siegermächte haben Deutschland besetzt und aufgeteilt. Der Osten steht unter sowjetischer Besatzung, darunter auch die Barockstadt Dresden. Das einst prachtvolle "Elbflorenz" ist eine Trümmerwüste. Durch den verheerenden Bombenangriff in der Nacht auf den 14. Februar 1945 sind 30 Prozent des Wohnraums völlig zerstört. Dass der Wiederaufbau der Stadt dennoch in Gang kommt, ist besonders den Frauen zu verdanken, im Volksmund Schipperinnen oder Trümmerfrauen genannt. Eine von ihnen ist Elli Göbel. Den schweren Job hat ihr das Arbeitsamt zugewiesen. Von dem niedrigen Lohn muss sie zwei Kinder ernähren, ihr Mann ist schon 1943 an der Ostfront gefallen. Bis Kriegsbeginn war Ellis Leben ganz anders sie war Geigenlehrerin im schlesischen Breslau. Als im Januar 1945 die Rote Armee vor der Stadt steht, macht sie sich mit ihrer Familie und Tausenden Flüchtlingen auf den langen Weg in Richtung Westen. Elli Göbels Eltern überleben die Tortur nicht, ihre Schwester Gerda gilt seither als vermisst. Doch Elli Göbel gibt die Hoffnung nicht auf, ihre Schwester doch noch wiederzufinden.
In Dresden ist die Versorgungslage 1946 miserabel. Ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen und die Nachricht, dass die engsten Verwandten überlebt haben, ist das, was für die Menschen damals zählt. Die Arbeit als Trümmerfrau oder Bauhilfsarbeiterin, wie es damals offiziell heißt ist entgegen der medialen Darstellung alles andere als beliebt: In der Enttrümmerung arbeitet nur, wer keine Wahl hat. Aber sie ist die einzige Möglichkeit, an die begehrten Lebensmittelmarken der Kategorie eins zu kommen. Bis heute hält sich hartnäckig der Mythos von der heldenhaften deutschen Trümmerfrau. Dabei arbeiten auf den Baustellen sowohl Frauen als auch Männer. Trümmerfrauen, wie sie im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert sind, hat es eigentlich nur in Berlin und der sowjetischen Besatzungszone gegeben. In den meisten westdeutschen Städten wird die Enttrümmerung schnell von Firmen mit schwerem Gerät übernommen. Und die Bilder von jungen lachenden Frauen, die man aus Schulbüchern kennt, sind oft gestellt.
Um in der Nachkriegszeit zu überleben, ist Einfallsreichtum gefragt. Lebensmittel sind knapp und Hunger eine echte Bedrohung. Ersatzprodukte wie die sogenannte "Stalinschmiere", eine Ersatzleberwurst aus Speiseölresten und Haferflocken, füllen wenigstens den Magen. Elli hebt auch Kartoffelschalen auf. Dank der Solanine, die in der Knolle stecken, schäumen sie wie Seife und sind als Putz- oder Waschmittel bestens geeignet. Alte Kleidung wird kurzerhand recycelt: Aus Gardinen oder Uniformen entstehen neue Jacken, Hosen und Kleider. In der Nachkriegszeit herrscht Nachhaltigkeit, so gut wie nichts wird weggeworfen.
Göbels großer Traum ist es, wieder als Musikerin zu arbeiten. Als sie eine Stellenanzeige des Plauener Tanzorchesters liest, will sie auf dem Schwarzmarkt ein Instrument für das Vorspiel organisieren, obwohl der Erwerb von Schwarzmarkt-Waren strafbar ist. Der Schwarzmarkt ist der Supermarkt der Nachkriegszeit. Dort wird schon mal ein Teppich gegen ein paar Lebensmittel oder Meißner Porzellan gegen ein Fahrrad getauscht. Die begehrteste Währung aber sind Zigaretten, Geld ist praktisch nichts mehr wert. Als Elli Göbel gerade ein Instrument gefunden hat, wird es plötzlich hektisch auf dem Markt. Die Polizei führt eine ihrer Razzien durch, und Göbel wird verhaftet. Ihr droht eine drakonische Strafe und im schlimmsten Fall sogar die Wegnahme ihrer Kinder.
in Outlook/iCal importieren